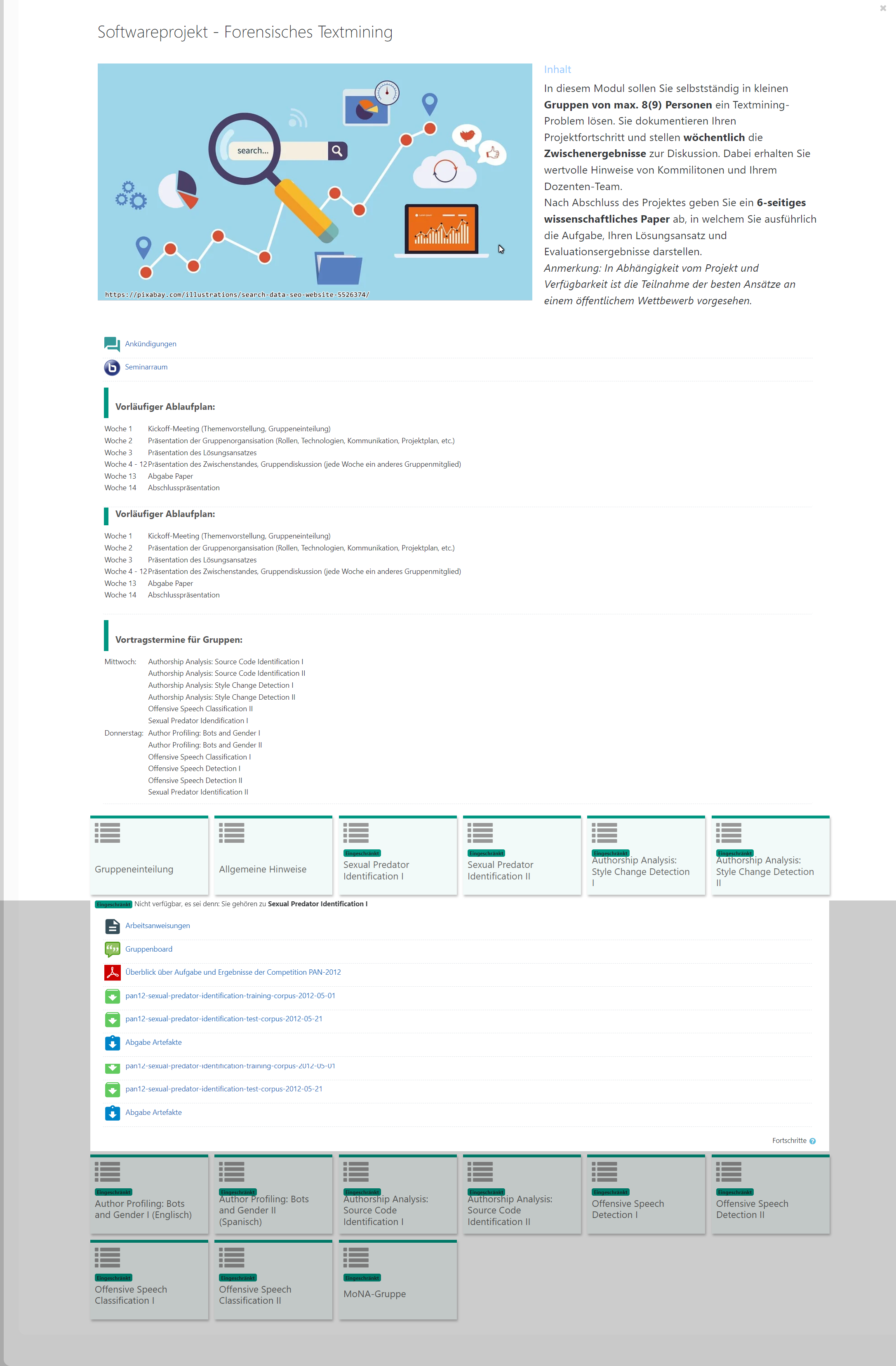Studierende tauchen ein in die Welt der Wissenschaft
Gute Hochschullehre zeichnet sich durch einen beständigen Einfluss aktueller Forschung auf Lehrinhalte und deren abwechslungsreiche, spannende und praxisnahe Präsentation aus. Aber das ist nur die halbe Wahrheit.
Zum Studium einer angewandten Wissenschaft gehört eben auch das selbstständige wissenschaftliche Arbeiten, also das Anwenden des Gelernten im Sinne eines Feedbacks in die Wissenschaft. Der Lehrende nimmt dabei die Position eines Supervisors und der Lernende die Position eines Wissenschaftlers ein. In diesem Beitrag möchte ich (m)einen Weg aufzeigen diesen Perspektivwechsel zu gestalten.
Wann bietet sich der Perspektivwechsel an?
Die ersten Fragen, die sich stellen, sind die nach dem geeigneten Zeitpunkt und einem passenden Modul Studierende in die Welt der Wissenschaft eintauchen zu lassen. Ganz im Sinne Ockhams‘ Rasiermesser – die naheliegendste Theorie ist oft die Beste -, drängte sich das Softwareprojekt im 5. Semester der Allgemeinen und Digitalen Forensik förmlich auf. Nicht nur, dass es zu einem idealen Zeitpunkt stattfindet, zu dem bereits auf fundamentales Wissen zurückgegriffen werden kann, ist es auch inhaltlich bereits darauf ausgelegt, selbstständig Gelerntes zu nutzen, um eine konkrete Aufgabe zu lösen.
In seiner ursprünglichen Fassung erlaubte dieses Modul aber nur sehr begrenzt Erfahrungen mit realer Wissenschaft zu sammeln, zu Lernen, wozu man sich bisher durchs Studium gequält hat oder gar die Frage zu beantworten, ob eine wissenschaftliche Karriere ins persönliche Lebenskonzept passt. Dazu muss jede/r Studierende für sich die Frage beantworten können:
„Wie fühlt sich Wissenschaft an?“
Und dafür reicht es nicht, irgendeine gestellte Aufgabe zu lösen und den Weg dahin in Form einer Belegarbeit zu beschreiben.
Diese Frage trieb mich lange um, bis mir eines Tages, wie so oft, der Zufall die Antwort vor die Füße legte. Im Rahmen der Forschungsarbeiten zu künstlichen Immunsystemen für soziale Netzwerke stießen wir auf einen interessanten Datensatz, der als Teil des German Evaluation Tasks veröffentlicht worden war.
Es ging darum, verletzende Rede in deutschen Tweets zu erkennen. Da dieses Thema von hoher strategischer Bedeutung für unsere aktuelle Forschung war und in dieser Form erstmalig im deutschsprachigen Raum aufgelegt wurde, entschloss sich unsere Arbeitsgruppe spontan daran teilzunehmen. Der Ablauf war klar strukturiert:
Phase 3
Moment,
das ist doch genau das, was empirische Forschung ausmacht!

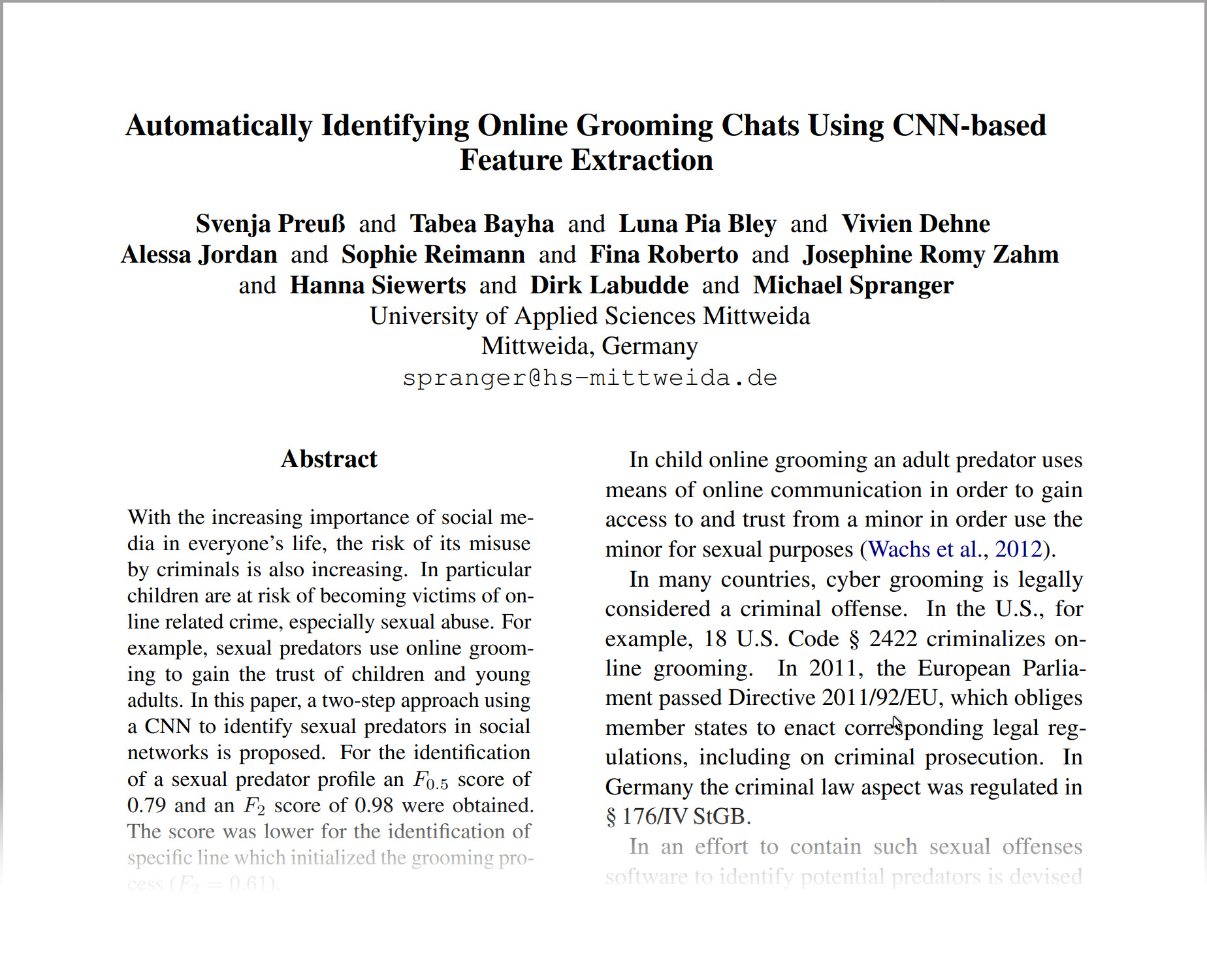
So kann die Bewertung aussehen
Dieser Aufsatz dient gleichzeitig als Belegarbeit und bildet gemeinsam mit den anderen erzeugten Artefakten die Grundlage für die Bewertung (Peer-Review) durch den Supervisor und einen weiteren Gutachter. Dieser Beleg wird anschließend ausführlich mit jeder Gruppe ausgewertet. So erhält jeder Studierende wertvolle Hinweise für das Schreiben der Bachelorarbeit in der sich anschließenden Bachelorphase.
Jede Gruppe muss außerdem in einem zwanzigminütigen Vortrag ihren Ansatz und die erzielten Ergebnisse vorstellen und sich anschließend den Fragen des Auditoriums stellen (Fachvortrag und Disputation). Die Gruppen sind dabei angehalten, mindestens eine Frage zu jedem Vortrag zu stellen.
Ein klarer Mehrwert für die Studierenden
Fallen Ausschreibung eines Wettbewerbs und Semester günstig zusammen, wird die beste Arbeit tatsächlich beim zugehörigen Wettbewerb eingereicht. Die Gruppe kann ihre Arbeit dann in der Konferenz unter realen Bedingungen vorstellen und verteidigen.
Andernfalls, erhält die beste Gruppe die Möglichkeit, sofern der State-of-the-Art überschritten wurde, gemeinsam mit dem Dozenten einen Beitrag für eine passende Fachkonferenz einzureichen und, sofern möglich, an der zugehörigen Konferenz teilzunehmen. In jedem Fall haben die Mitglieder der erfolgreichsten Gruppe (n) ihr erstes wissenschaftliches Paper veröffentlicht.
Auf diese Weise entstanden in den letzten Jahren hervorragende Beiträge, welche für Anerkennung in der Fachwelt sorgten.
Aus dem Modul entstandene Publikationen
Screenshot der Moodle Plattform